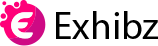Mehr als ein Hype – und hilfreich vom ersten Tag an

Das Thema Digitalisierung ist weiterhin in aller Munde, auch wenn sich die Stimmen mehren, wonach es sich dabei nur um einen weiteren Technologie-Hype handelt. Doch selbst wenn die Digitalisierung nicht für jedes Unternehmen überlebenskritisch sein mag: Sie ist eine Chance, um die eigene Wettbewerbsfähigkeit auf den Prüfstand zu stellen.
Vorab: Was soll im Kontext dieses Artikels unter „Digitalisierung“ verstanden werden?
In ihrem Fachaufsatz „How smart connected products are transforming competition” bieten der Harvard-Professor Michael E. Porter und Jim Heppelmann, der CEO des Techkonzerns PTC, eine gute Definition. Dem folgend werden wir dann von Digitalisierung sprechen, wenn anhand digitalisierter Produkte, Dienste und Prozesse ein nachhaltiger Wettbewerbsvorteil erschlossen werden kann (der Artikel ist am Ende dieses Beitrages verlinkt).
Neue, bessere Dinge tun – und nicht lediglich die bisherigen Dinge verbessern: Das ist die Grundidee des Ganzen. Entscheidet sich beispielsweise ein Hersteller von Klimaanlagen, seine Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und seinen Kunden unter Verwendung digitaler Technologien ein zu Raumklima „garantieren“, anstatt weiterhin lediglich Klimaanlagen an sie zu verkaufen, so haben wir einen Fall von Digitalisierung vorliegen. Führt hingegen ein Medizintechnikunternehmen ein softwarebasiertes Dokumentenmanagement-System ein, um Suchaufwände für seine Mitarbeiter zu minimieren, haben wir lediglich eine Verbesserung eines bestehenden Geschäftsprozesses – aber keinen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil.
Die Digitalisierung und ihre Folgen
Es gibt zahlreiche Gründe, warum das Thema Digitalisierung derzeit mit Macht um sich greift; die parallele und beschleunigte Entwicklung von Schlüsseltechnologien ist einer davon. Dazu zählen wir hier unter Anderem. das Internet der Dinge (IoT), Big Data Analytics, künstliche Intelligenz oder Augmented Reality. Porter und Heppelmann sprechen auch von der „Third Wave of IT-Driven Competition”. Viele Manager fragen sich jedoch, wie relevant das Thema für ihre Unternehmen eigentlich ist: Welche Effekte hat die Digitalisierung auf das eigene Geschäft? Was sind die richtigen Schritte, die man heute ergreifen sollte?
Die individuellen Antworten auf diese Fragen hängen ab vom Geschäftsmodell, dem eigenen Team und der Unternehmenskultur. Manche Unternehmenslenker lassen mehrere Digitalisierungs-Initiativen gleichzeitig zu, andere fokussieren sich lieber auf eine einzige; wieder andere schließen Technologiepartnerschaften oder externalisieren ihre Aktivitäten über Ausgründungen oder Akquisitionen. Und so mancher wird sich schließlich sagen, dass Abwarten erstmal die beste aller Alternativen zu sein scheint.
Wir wollen uns hier den oft übersehenen, aber sehr konkreten Vorteilen widmen, welche allein schon die Beschäftigung mit der eigenen Digitalisierungsstrategie grundsätzlich mit sich bringt. Denn unabhängig davon, welche Strategie letztlich verfolgt wird – die Frage nach der Digitalisierungsfähigkeit wirft ein Schlaglicht auf zentrale Kernkompetenzen bzw. Charakteristika des eigenen Unternehmens, nämlich:
- Das eigene Geschäftsmodell
- Das Daten- und Informations-Management
- Das vorhandene Kundenwissen
- Das Portfolio-Management (Initiativen, Technologien, Partner)
- Die kulturelle Wandlungsfähigkeit
Diese Kompetenzen und deren Bedeutsamkeit sind nicht neu. Die Digitalisierung hat aber das Zeug dazu, Schwächen aufzudecken, die Unternehmen in diesen Bereichen haben – und die bisher noch nicht erkannt wurden.
Im Folgenden sollen einige typische Problemfelder erläutert werden, die im Zusammenhang mit Digitalisierungsinitiativen in Unternehmen oft ins Bewusstsein rücken.
Digitalisierte Geschäftsmodelle lassen sich nur schwer bestimmen
Den Begriff der Digitalisierung einmal außen vor gelassen: Wie oft fragen sich Unternehmen heute generell, ob und wie sie ihr komplettes Geschäftsmodell verändern sollten – anstelle von lediglich evolutionären Produktinnovationen? Und wie ist es um die dazu notwendigen Kenntnisse, Mitarbeiter und Werkzeuge bestellt – sind sie beispielsweise in der Lage, Prototypen für neue Geschäftsmodelle zu entwickeln? Mit Produktinnovationen lässt sich vielleicht für eine gewisse Zeit der nächste Wettbewerber auf Distanz halten, doch echte Innovationen im Geschäftsmodell können für Disruptionen kompletter Branchen sorgen.
Wer sich mit Digitalisierung beschäftigt, kommt am Thema „Business Model Innovation“ nicht vorbei. Wenn sich hier Schwierigkeiten zeigen (weil etwa Personal, Methoden oder Werkzeuge fehlen), dann ist es höchste Zeit, dagegen vorzugehen. Denn eines ist klar: Unabhängig davon, welche Tragweite der Einzelne dem Thema Digitalisierung heute beimisst – kaum jemand wird bestreiten, dass er sich früher oder später über sein künftiges Geschäftsmodell Gedanken machen muss. Das trifft auf jede Branche zu, vom Einzelhandel bis zur Mikroelektronik; alle haben bereits Disruptionen in Ihren Geschäftsmodellen erlebt und werden mit ziemlicher Sicherheit auch weitere erleben.
Digitale Geschäftsprozesse erfordern mehr Datenmaterial
Hier lassen sich zwei „Varianten“ des Grundproblems unterscheiden, die sich beide auf Produkt- und Kundendaten beziehen.
Fall eins: Daten sind zwar vorhanden, aber nicht nutzbar (da fehlerbehaftet, unvollständig, nicht aktuell etc.). Bereichsübergreifendes Sichten oder gemeinsame Daten-Pools sind noch wenig verbreitet und schwer zu realisieren, Datenanalysen sind aufwendig und fehleranfällig. An dieser Stelle lösen wir uns wieder vom eigentlichen Vorhaben der Digitalisierung und stellen die Frage: Ist es nicht ein alarmierendes Warnsignal, wenn Daten nicht akkurat sind, nicht geteilt, gewartet und bereichsübergreifend genutzt werden können? Was, wenn etwa künftige Gesetzesvorschriften das Vorhalten solcher Daten verlangen? Man kann sich kaum ein Unternehmen vorstellen, für das die interfunktionale Zusammenarbeit auf Basis sauberer Datengrundlagen nicht grundsätzlich vorteilhaft wäre.
Das zweite Teilproblem: Daten sind gar nicht erst vorhanden, weil Kunden- oder Produktnutzungsdaten schlicht nicht erfasst werden. Es sollte im Interesse jedes Unternehmens liegen, möglichst viel über das eigene Geschäft zu wissen sowie die eigenen Kunden bzw. deren Umgang mit den eigenen Produkten oder Dienstleistungen bestmöglich zu verstehen. Denn – so banal es klingt: Je besser Unternehmen das eigene Geschäft versteht, desto eher können sie sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Gibt es hier Schwächen, bietet sich im Zuge von Digitalisierungsmaßnahmen die Gelegenheit, die eigene Datenakquise und -analyse näher unter die Lupe zu nehmen und ggf. zu verbessern.
Probleme beim Zahl- und Preismodell für das digitalisierte Geschäft
Wie ist es um das Wissen in Bezug auf die Zahlungsbereitschaft künftiger Kunden bestellt? Wie gut kennen Unternehmen ihre Bestandskunden und den Wert, den die eigenen Produkte, Lösungen und Dienste für die Kunden darstellen? Welches Ergebnis verspricht sich der Kunde von deren Nutzung? Sollte das Produkt verkauft oder vielleicht doch eher vermietet werden? Basieren heutige Preise auf einer solchen, nüchternen Wertbetrachtung (evtl. sogar gestützt durch Studien), oder eher auf einer „Cost-Plus“-Kalkulation und Wettbewerbsbenchmarks? Vielleicht ist es an der Zeit, die Themen Preisstrategie und Zahlmodelle einer Revision zu unterziehen und für die nötigen Fertigkeiten bzw. Instrumente zur Analyse zu sorgen; hier liegen oftmals große Margenpotenziale versteckt.
Die Kosten digitaler Geschäftsmodelle sind schwer einschätzbar
Es erscheint schwierig, umfassende Kostenszenarien zu erstellen, wenn man die künftige Dynamik des digitalisierten Geschäftes nicht kennt; dazu braucht es u.a. die zuvor diskutierten Fertigkeiten. Fehler in der Kostenmodellierung können größere Digitalisierungs-Vorhaben in ein Margen-Desaster verwandeln. Wie gut ist das Unternehmen heute aufgestellt, um solide Kostenbetrachtungen zu erarbeiten? Diese sind ja nicht nur im Falle von Digitalisierungsvorhaben hilfreich, sondern bei jeglicher Investitionsentscheidung. Wie gut reflektieren die heutigen Ansätze Szenarien unter großer Unsicherheit? Und: Welche Möglichkeiten und Erfahrungen gibt es, Kosten effektiv zu beeinflussen, wenn das notwendig werden sollte?
Es ist schwierig, die richtigen Technologien und Partner zu finden
Ohne Zweifel erhöhen IoT, Big Data oder Augmented Reality die Komplexität und den Umfang des zu beherrschenden Technologie-Portfolios. Viele neue Anbieter erscheinen auf der Bildfläche und treten neben die bereits alteingesessenen. Auch können die verbundenen Programme und Projekte schnell sehr anspruchsvoll werden – sie verlangen nach kundiger, interdisziplinärer Führung und oftmals einem umfassenden Konglomerat an kompatiblen und abgestimmten Partnern. Das ist eine bedeutsame Veränderung, nachdem jahrelang Mainstream-Systeme wie ERP, CRM, MES oder PLM von spezialisierten und eingeübten IT-Abteilungen im Alleingang betreut wurden.
Allerdings: Es war schon immer eine zentrale Kernkompetenz des Managements, Zukunftstechnologien zu identifizieren, zu testen und zu adaptieren – im Sinne eines wettbewerbsfähigen Technologieportfolios. Auch die heutigen Mainstream-Systeme waren einmal neu, ihre Implementation eine Herausforderung. Heute verlangt die Integration neuer Technologien aufgrund deren Komplexität jedoch zunehmend eine enge Verzahnung verschiedener Funktionsbereiche bzw. Abteilungen – wie z.B. Produktmanagement, Entwicklung, IT und Einkauf. Wenn Unternehmen heute feststellen, dass ihr Technologie- und Partner-Portfolio-Management nicht funktioniert (was man bspw. an häufigen, unkoordinierten und wenig differenzierten Anbieterausschreibungen feststellen kann), dann ist es höchste Zeit für Veränderungen. Denn wie lassen sich die Potenziale der Digitalisierung einschätzen, wenn die relevanten Technologien nicht bekannt sind und verstanden werden?
Wir haben weder die richtigen Leute noch die passende Kultur
In zehn Jahren wird das notgedrungen anders sein – denn andernfalls werden sich Unternehmen schwer tun, unter den dann dominierenden, berufstätigen „Digital Natives“ Nachwuchs zu rekrutieren. Es wird heute kaum möglich sein, alle vorhandenen, langjährigen Mitarbeiter in technologie- und wandelaffine „Geeks” zu verwandeln. Andererseits sind die reflexartigen Ausgründung von Start-Ups oder „Digital Labs“ und die Durchführung von Inspirations-Trips ins Silicon Valley oftmals nicht ausreichend, um den nötigen kulturellen Wandel im Kern voranzutreiben. Wenn die grundsätzliche Bereitschaft, Neues zu erkunden und sich zu verändern, nicht fest in der Unternehmenskultur verankert und vom Führungsteam vorgelebt wird, dann wird jeder zukünftige Wandel eine große Herausforderung werden.
Zusammengefasst
Treten wir einen Schritt zurück: Die Digitalisierung bietet uns die Chance zur kritischen Selbstreflexion über unsere Kernkompetenzen. Der Weg sollte das Ziel sein – unabhängig davon, ob man sich entschließt, das nächste “Uber” zu werden oder „nur“ das Kerngeschäft zukunftsfähig zu machen. In dieser Funktion verlangt die Digitalisierung die volle Aufmerksamkeit der Unternehmensleitung, über alle Funktionsbereiche hinweg und mit dem Mandat, Dinge entschlossen umzusetzen. So verstanden funktioniert die Digitalisierung wie ein Katalysator für die eigenen Kernkompetenzen: Werden diese geschärft, dann machen sich Unternehmen gleichzeitig fit für eine Welt im Wandel.
Roland Riedel ist in leitender Funktion für die Strategieberatung PTC tätig.